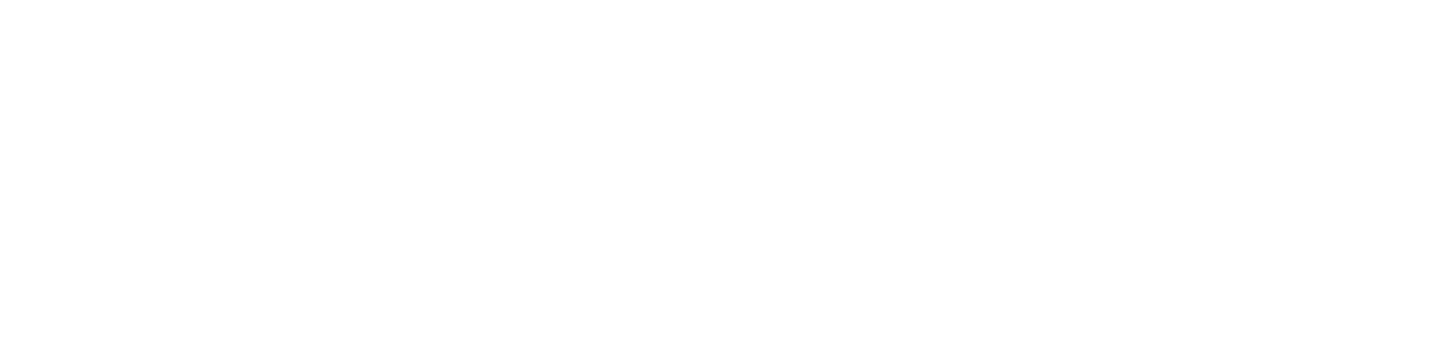4 Fragen an… Sebastian Stütz
Sebastian Stütz lehrt seit dem Wintersemester im Bereich „Urbane Logistik“ am Campus Recklinghausen. Hier gibt er Einblicke in die aktuellen Herausforderungen und Potenziale der urbanen Logistik, insbesondere im Hinblick auf nachhaltige Transportlösungen. Wie können Städte und Logistikunternehmen gemeinsam Verkehrsstaus und Umweltbelastungen verringern, und warum sind andere Länder wie die Niederlande in diesen Aspekten meist weiter fortgeschritten? Vier Fragen zu den Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität und den Perspektiven für die Zukunft.
Welche Rolle spielen nachhaltige Transportlösungen wie z. B. Lastenfahrräder in der Verkehrslogistik von heute?
Lastenräder spielen mengenmäßig in der urbanen Logistik eine sehr geringe Rolle. Das soll nicht heißen, dass sie nicht ihre Berechtigung haben und eine gute Transportmöglichkeit bieten, sofern die Güter dazu passen. Bei der Post und der Auslieferung in bewohnten Gebieten passt es z. B.: Die Güter sind klein, es geht um kurze Strecken, man kann überall ohne Suchzeiten für einen Parkplatz anhalten, Häusereingänge werden unmittelbar erreicht. Man benötigt allerdings einen Startpunkt vor Ort. LKW liefern die Pakete daher an sogenannten Mikrodepots an, von dort aus werden sie von den Fahrrädern aufgenommen und ausgeliefert. Jedoch wirken sich diese Kleinstsendungen nicht auf die große Menge der Güterlieferungen aus. Hinzu kommt der Faktor Personalintensität.
Wie können Städte und Logistikunternehmen zusammenarbeiten, um Verkehrsstaus und Umweltbelastungen zu reduzieren, ohne die Effizienz der Lieferketten zu beeinträchtigen?
Ohne wirtschaftlichen Druck wird sich das bestehende System nicht verändern. Es sind so viele Beteiligte in der urbanen Logistik, dass man dafür sorgen muss, dass derjenige in der städtischen Verwaltung, der den Transport von Gütern in die Stadt verantwortet, dies auch bewusst nachhaltiger gestalten möchte. Dafür gibt es kein Patentrezept. Die City of London hat z. B. eine Maut für die Innenstadt eingeführt, insbesondere für Verbrenner-Fahrzeuge. Das hat zu einer hohen Elektrifizierung bei den großen Logistikketten geführt. Um die mittelständisch geprägten Speditionen miteinzubeziehen, muss man jedoch deren Auftraggeber adressieren. Es müssen wirtschaftliche Anreize geschaffen werden, die für eine grüne Belieferung sprechen, bspw. Steuererleichterungen für Händler, die emissionsfreie Lieferungen umsetzen.
Warum sind andere Länder wie die Niederlande in dieser Hinsicht so viel weiter als wir?
In den Niederlanden ist die PKW-Steuer z. B. sehr teuer. Daher wird u. a. so viel Fahrrad gefahren. Innenstadtparkplätze für Anwohner haben in Amsterdam beispielsweise sehr lange Wartelisten – wer ein E-Auto hat, rückt auf dieser Liste vor. Darüber hinaus gibt es in den Niederlanden keine eigenen nennenswerten Autohersteller. Damit geht einher, dass man nicht so sehr am Auto hängt wie hierzulande. Hinzu kommt, dass Deutschland sich als Auto-Nation eine ganze Industrie rund um den Verbrennermotor geschaffen hat, von der man sich nur langsam löst. Die Niederlande haben als Handelsnation verstanden, dass funktionierende Mobilität für sie extrem wichtig ist. In Belgien sieht das mit den Seehäfen, die ganz Europa versorgen, wenig anders aus. Hier herrscht die Auffassung vor, dass es funktionieren muss, dass die LKW von A nach B fahren. Wenn die LKW die Städte mit ihren Emissionen belasten, muss die Technologie eben sauber werden.
Wann werden E-LKW nach Ihrer Auffassung einen nennenswerten Marktanteil in Deutschland erreichen?
Ich habe in der Vergangenheit im Auftrag einer Tankstellenkette eine Studie zu dem Thema erstellt. Darin wurden verschiedene Hochlaufszenarien für E-LKW skizziert. Ich denke, dass wir in den nächsten sechs bis sieben Jahren eine deutliche Zunahme bis auf rund zehn Prozent sehen werden. Mit Diesel betriebene LKW werden in diesem Zeitraum noch die Mehrheit ausmachen, aber das Ende ist absehbar. DB Schenker hat einige große E-Fahrzeuge gekauft, andere große Logistikketten ebenfalls. MAN hat verkündet, 3.000 große, schwere E-LKW verkauft zu haben und es gibt noch weitere Hersteller, die nennenswerte Modelle anbieten. Das ist eine beachtliche Entwicklung. Bei den kleineren Lieferfahrzeugen wird es im Dieselbereich keine Zuwächse mehr geben. Bei den schweren E-LKW stellt die Ladeinfrastruktur jedoch derzeit noch eine Herausforderung dar, hier müssen noch weitere Kapazitäten geschaffen werden, um die Elektromobilität in diesem Bereich voranzutreiben.